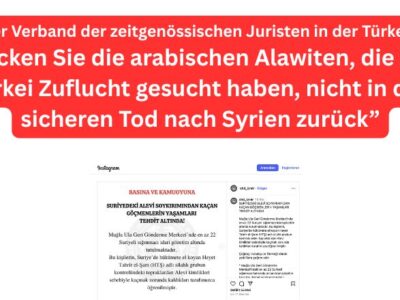In den zahlreichen Rückmeldungen wurden uns vor allem Fragen zur Bedeutung von Kopftuch, Burka, Burkini, Hijab und Chador im Koran und in der islamischen Religion gestellt, beispielsweise: Warum verursacht blinder Kadavergehorsam gegenüber unantastbaren Werken so viel Gewalt und Verachtung? (Artikel 2010)
Wir kommen den Bitten um Beantwortung nun gerne nach, möchten aber vorab Folgendes betonen: Wir sind weder politische noch religiöse Vertreter. Hier geht es um sachliche, fundiert argumentierte Kritik mit profunder, nüchterner Wissensvermittlung und nicht um rüde Anwürfe und pauschale Verunglimpfungen.
Ein Aufklärungsversuch
Mündigkeit, Unmündigkeit, Entmündigung!
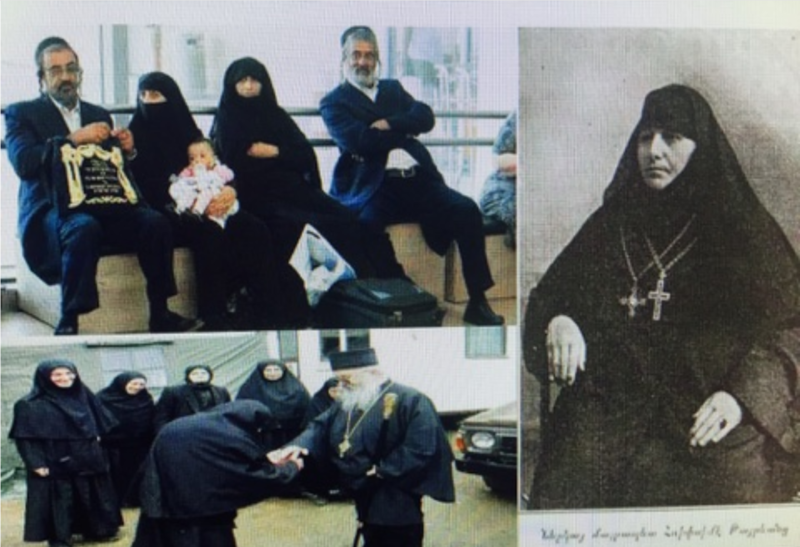

Man kann durchaus sagen Kopftuch, Kopfbedeckung, Schleier stammt aus der Tora und dem neuen Testament aber nicht aus dem Koran.
Der Begriff „Mündigkeit” beschreibt das innere und äußere Vermögen zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Mündigkeit ist ein Zustand der Unabhängigkeit. Er besagt, dass man für sich selbst sprechen und sorgen kann.
Als Österreicher mit einer säkularen Lebenseinstellung trete ich für uneingeschränkte Meinungsfreiheit ein und spreche mich grundsätzlich nicht gegen Kleidervorschriften aus. Ich bin jedoch gegen den Vollschleier (Burka, Niqab), da dieser für uns ein Zeichen von Entmündigung ist und für ein abwertendes Frauenbild steht. Die Entmündigung wurde in Österreich 1984 und in Deutschland 1992 abgeschafft.
Seit Immanuel Kant hat der Begriff der Mündigkeit eine geschichtsphilosophische Bedeutung. In seinem berühmten Text „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” von 1784 schreibt Kant:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, seinen Verstand ohne Leitung eines anderen zu benutzen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache nicht im Mangel des Verstandes, sondern in der fehlenden Entschlossenheit und dem fehlenden Mut liegt, sich ohne Leitung eines anderen seines Verstandes zu bedienen. ‚Sapere aude!‘, also ‚Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!‘, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Dass die Menschen sich in Religionsdingen ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen vermögen, ist noch in weiter Ferne.“
Hier sollten wir doppelt aufpassen. Denn die Aufklärung projiziert den Prozess des Erwachsenwerdens von der Unmündigkeit zur Mündigkeit auf die allgemeine Menschheitsgeschichte. Der Begriff der Mündigkeit dient dabei als zentrales Instrument zur Legitimation der Auffassung, dass Geschichte als Fortschritt zu begreifen ist. So die allgemeinen Erklärungen.
Das ist England vor 109 Jahren. Sehen Sie sich an, wie die Frauen gekleidet waren.
Was sagen die Fotos aus Wien? Sie verwenden 21. Jahrhundert Technologie sehr penibel
Was sagt der EGMR?
Laut vielen Berichten hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in einem europaweit maßgeblichen Urteil das Verbot des Ganzkörperschleiers in Frankreich gebilligt. In Straßburg wiesen die Richter die Beschwerde einer französischen Muslimin in allen Punkten zurück. Das Verbot stelle keine Diskriminierung dar, verstoße nicht gegen den Schutz des Privatlebens und auch nicht gegen die Meinungs- und Religionsfreiheit, hieß es zur Begründung.
Noch dazu: Niqab und Burka sind nicht durch den Koran gedeckt, sondern ein regionaler Brauch, der nicht durch die Glaubensfreiheit geschützt wird. Für die TKG bedeutet Toleranz nicht, alles anzuerkennen, was von außen an eine Gesellschaft herangetragen wird. Der weltoffene, säkular-freiheitlich-pluralistische Staat hat die Aufgabe, hier eigene Maßstäbe zu setzen und zu verteidigen.
Meinungen, die auf die (politische) Instrumentalisierung bestimmter Kleidungsstücke in Österreich bzw. in der EU abzielen, lassen wir allerdings nicht gelten. „Vollschleier wie Burka und Niqab gehören nicht nach Europa. Sie stellen eine Kampfansage an die Werte der Aufklärung dar und degradieren Frauen zu Objekten männlicher Verfügungsgewalt.“ Diesen oder ähnliche Kommentare hört man seit Jahren.
Wir müssen aufklären.
„Jede Religion muss sich den Ansprüchen der prüfenden, kritisierenden und forschenden Vernunft unterwerfen.“
Die Antwort, warum wir aufklären müssen, gibt Konrad Paul Liessmann, Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien, in seinem Buch „Die Praxis der Unbildung“ (Zsolnay Verlag, 2014), mit den folgenden Worten:
„Untrennbar ist dieser Begriff – Aufklärung – an die Metapher des Lichts und damit des Sehens gebunden. Es geht um die Herstellung von Verhältnissen, in denen alles Dunkle, Verborgene, Falsche, Verdüsterte, aber auch jeder falsche Schein, jedes Blendwerk, jede Täuschung und jede Illusion ihrer Unwahrheit überführt werden. Aufklärung tut nur dort not, wo die Gedanken und Sinne der Menschen vernebelt sind, wo an angeblich unumstößliche Wahrheiten geglaubt werden muss und vermeintliche Gewissheiten oktroyiert werden. Aufklärung setzt demgegenüber darauf, dass Wahrheitsansprüche, Weltdeutungen, moralische Einstellungen und politische Überzeugungen kritisch überprüft und aus Vernunftgründen einsichtig, zumindest plausibel gemacht werden müssen. Jede Religion muss sich jedoch den Ansprüchen der prüfenden, kritisierenden und forschenden Vernunft unterwerfen. Es ist ein grobes Missverständnis, dass die Vernunft gegenüber Glaubenswahrheiten tolerant sein müsse; die Vernunft habe nichts zu dulden, was ihren Ansprüchen nicht genüge. Wären die Aufklärer und Religionskritiker – von Voltaire über Feuerbach bis zu Marx, Nietzsche und Freud – ähnlich wie wir besorgt gewesen, keine religiösen Gefühle zu verletzen, hätte es keine Aufklärung, keine Menschenrechte und keine moderne Lebenswelt gegeben.
Nur zur Sache!
Der Textbefund in der Bibel und im Koran?
Während das Kopftuch im Alten und Neuen Testament de Jura und de facto verpflichtend vorgeschrieben wird, kommt das Wort „Kopftuch“ im Koran nicht einmal vor, allenfalls das „Tuch“ auch nicht als „Kopf-TUCH Gebot“ vor.
Jüdische Quellen zur Kopfbedeckung der Frau
1. Talmud Bavli – Ketubot 72a: Die Pflicht zur Kopfbedeckung für verheiratete Frauen Die Mischna erklärt, dass eine Frau, die mit unbedecktem Kopf aus dem Haus geht, gegen die Vorschriften jüdischer Frauen verstößt und ohne Zahlung ihres Ehevertrags geschieden werden kann.
Artikel auf Bibel-Lernen.de mit Talmud-Zitat A
2. 4. Mose 5:18 – Die Enthüllung des Hauptes als Zeichen der Schande . In der Tora wird beschrieben, dass bei Verdacht auf Untreue das Haupt der Frau öffentlich aufgedeckt wird – was zeigt, dass das bedeckte Haar als Zeichen von Ehre galt.
Ausführliche Erklärung im selben Artikel A
3. Schulchan Aruch – Even HaEzer 21,2 „Jüdische Frauen sollten nicht mit bloßem Haupt zum Markt gehen.“ Diese Halacha gilt ausschließlich für verheiratete Frauen und ist ein Ausdruck von Zniut (Bescheidenheit).
Glossarartikel zur Kopfbedeckung in der Jüdischen Allgemeinen
4. Zohar – K Babbalistische Sicht auf vollständige Bedeckung Der Zohar (Band 3, Seite 126a) fordert, dass das gesamte Haar der Frau bedeckt sein muss und verspricht spirituellen Segen für die Familie.
Jüdische Allgemeine über Scheitel und Zniut B
5. Historische und interreligiöse Perspektive . Auch im traditionellen Judentum war es üblich, dass verheiratete Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch oder eine Haube trugen – ähnlich wie im Islam und Christentum.
Im Christentum ist die Frage der Kopfbedeckung bei Frauen vor allem durch den ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther geprägt. In Kapitel 11, Verse 3 bis 15, argumentiert Paulus, dass jede Frau, die beim Beten oder prophetischen Reden ihr Haupt nicht bedeckt, ihr Haupt entehrt. Er vergleicht dies mit einer kahlgeschorenen Frau und fordert, dass Frauen ihr Haupt bedecken sollen, wenn sie sich öffentlich religiös äußern. Diese Passage gilt als zentrale biblische Grundlage für die Praxis der Kopfbedeckung im christlichen Kontext. Die Kopfbedeckung wird hier nicht nur als Zeichen der Bescheidenheit, sondern auch als Ausdruck der göttlichen Ordnung zwischen Mann, Frau und Christus verstanden.
Historisch gesehen war die Kopfbedeckung für Frauen in der frühen Kirche weit verbreitet. In vielen christlichen Kulturen – insbesondere im Mittelalter und bis ins 19. Jahrhundert – war es üblich, dass verheiratete Frauen ihr Haar in der Öffentlichkeit bedeckten. Dies geschah durch Schleier, Hauben oder Tücher und wurde als Zeichen von Ehre, Keuschheit und Zugehörigkeit zur Ehe verstanden. Der Brautschleier, wie er heute noch bei christlichen Hochzeiten verwendet wird, ist ein direktes Erbe dieser Tradition und symbolisiert Reinheit sowie den Übergang in den Ehestand.
Weitere biblische Stellen wie 1. Petrus 3,3–4 und 1. Timotheus 2,9–10 betonen die Bedeutung von innerer Schönheit und Bescheidenheit gegenüber äußerem Schmuck. Zwar wird das Kopftuch hier nicht explizit erwähnt, doch unterstützen diese Verse die Idee eines zurückhaltenden und respektvollen Auftretens, das mit der Praxis der Kopfbedeckung in Verbindung gebracht werden kann.
In der modernen christlichen Theologie wird die Kopfbedeckung unterschiedlich bewertet. Während konservative Gruppen weiterhin auf die Einhaltung der paulinischen Anweisungen pochen, sehen viele Kirchen die Praxis heute als kulturell bedingt und nicht als verpflichtendes religiöses Gebot. Dennoch bleibt die Kopfbedeckung ein bedeutendes Symbol für die historische Verbindung von Glauben, Geschlecht und gesellschaftlicher Ordnung.
Hier die Quellen:
• 1. Korinther 11,3–15 (Lutherbibel 2017): https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther11
• Jesus.de – „Sollten Christinnen laut der Bibel ein Kopftuch tragen?“: https://www.jesus.de/glauben-leben/sollten-christinnen-laut-der-bibel-ein-kopftuch-tragen/
• Gesunde Lehre Christi – „Biblische Lehre über die Kopfbedeckung“: https://www.gesunde-lehre-christi.net/de/kopftuch.html
• Jesus-Info.de – „Dürfen Christen Kopftuch tragen?“: https://www.jesus-info.de/duerfen-christen-kopftuch-tragen/
Kopftuch im Islam
Der Koran meint mit „Tuch” aber kein Kopftuch, sondern ein Tuch, das den Frauen als Schmuck dienen und ihre sexuellen Körperstellen (Scham) verhüllen soll (siehe die entsprechenden Suren in deutscher Sprache unten).
Wenn der Koran die einzig verbindliche, als wahr vorausgesetzte Quelle ist, aus der die verbindlichen Gebote und Verbote abgeleitet werden, und das Wort „Tuch“ tatsächlich nur in drei Versen vorkommt, nicht aber das Wort „Kopftuch“, werfen sich berechtigte Fragen auf. Warum ist das Tragen eines Kopftuchs dann ein Gebot im Islam?
Warum stellen wir diese Frage? Damit wir nicht unter dem Vorwand der Religionsfreiheit betrogen, manipuliert oder ausgebeutet werden.
„Der Koran lehnt Schirk (Beigesellung), Ausbeutung und Manipulation ab!“ Die unverzeihliche Sünde: Schirk (širk = Beigesellung).
Am 16. Februar 2017 veröffentlichte der Mufti der Glaubensgemeinschaft ein Fatwa (religiöses Rechtsurteil) zur Stellung des Kopftuchs bzw. der Verhüllung im Islam. Diese autoritäre, jedoch nicht bindende Fatwa erfordert eine tiefgreifende Stellungnahme in Österreich sowie eine dringend notwendige innerislamische Debatte darüber, wie MuslimInnen ihre Religion hier und heute verstehen. Mir geht es dabei nicht darum, ob muslimische Frauen ein Kopftuch tragen müssen oder nicht. Vielmehr geht es mir in dieser Frage darum, wie und mit welchen Quellen wir unsere Religiosität in der Gegenwart begründen und welche unantastbaren Wahrheiten MuslimInnen geboten werden. In der Fatwa der Glaubensgemeinschaft wird das Kopftuch mit den vier Rechtsschulen des sunnitischen Islam begründet. Dabei wird auf gegenwartsorientierte Selbstdeutungen des Korans verzichtet und stattdessen auf Deutungen aus dem 8. und 9. Jahrhundert zurückgegriffen, die als farḍ (absolute Pflicht) bezeichnet werden. Damit werden die Meinungen der Rechtswissenschaftler und die göttlichen Aussagen auf eine gleiche Ebene gestellt.
Anders formuliert werden den Meinungen unzweifelhaft göttliche Eingebungen zugeschrieben, obwohl der Koran solche Zuschreibungen sehr ausdrücklich als Schirk (Beigesellung) ablehnt, die als unverzeihbare Sünde gilt (Koran: 9:31).
Dieses Recht stand nicht einmal dem Propheten zu, etwas als erlaubt oder verboten zu erklären (Koran: 66:1).
Wenn man die Meinungen solcher Gelehrter aus ihrem Kontext reißt und unüberlegt in die Gegenwart überträgt, legitimiert man Gewalt und die Unterdrückung der Selbstbestimmung von Menschen. Wenn wir einem Wissenschaftler des 9. Jahrhunderts, der in dieser Fatwa erwähnt wird, nämlich Imam Schāfiʿī, folgen, dann sollten wir seiner Meinung nach alle Muslim*innen töten, die das Gebet nicht verrichten. Ähnlich denkt auch ein anderer Gelehrter namens Imam Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. Er befürwortet nicht nur die Tötung, sondern auch die Folter von Muslimen, die nicht beten. Nach diesem Verständnis sind Frauen sogar verpflichtet, Niqab (Gesichtsschleier) zu tragen. Der IGGiÖ-Mufti schreibt dazu: „Dazu zählt auch die Freiheit, der Minderheitenmeinung (Hanbaliten und ein Teil der Schafiiten) zu folgen, die auch die Gesichtsbedeckung als religiös geboten (farḍ) erachtet.“
Dabei nimmt die IGGiÖ überhaupt keinen Bezug darauf, welche Folgen diese Pflicht für die Gesellschaft und die Frau selbst haben könnte. Bemerkenswert finde ich auch den Umgang mit den Hadithwerken von al-Buḫārī oder Muslim, die vom IS oder anderen radikalen Gruppen mit gleicher ergebener und gehorsamer Andacht salbungsvoll zitiert werden. Hier geht es nicht um die Ablehnung dieser Werke, sondern darum, mit welcher Autonomie MuslimInnen damit umgehen. Die blinde Kadavergehorsamkeit diesen Werken gegenüber verursacht viel Gewalt und Verachtung. Angesichts dieser Fakten können solche Aussagen niemanden mehr überzeugen, vor allem nicht die Behauptung, dass alles, was der IS macht, nichts mit dem Islam zu tun habe. Und trotzdem versuchen wir dann, den Alltag der MuslimInnen mit gleichen unkritischen und unaufmerksamen Argumenten zu definieren.“ (Prof. Dr. Ednan Aslan, Institut für Islamisch-Theologische Studien, Universität Wien)
Das wollen wir nicht. Deswegen: sachliche Aufklärung!
Im Koran gibt es nur drei Verse bezüglich „Kopf“, „Tuch“ und „Schleier“, aber das Wort „Kopf-Tuch“ sucht man darin vergeblich.
Im Rahmen einer kurzen geschichtlichen Spurensuche wollen wir sowohl das Alte als auch das Neue Testament im Vergleich zum Koran unter die Lupe nehmen.
1) Sure 24, Vers 31
2) Sure 24, Vers 60
3) Sure 33, Vers 59.
Wir wollen klären, inwiefern das Kopftuch seine Legitimation bzw. sein Gebot aus den besagten drei Versen des Korans, nämlich den immer zitierten Suren 24, Vers 31 und 60 sowie Sure 33, Vers 59, bezieht. Außerdem möchten wir etwas detaillierter auf das Kopftuch sowie auf religiöse und sittliche Konventionen semitischer Religionen im Allgemeinen eingehen und dabei aufzeigen, wie der Islam in Österreich und auch in der EU bzw. in der Welt zu Zwecken der Propaganda, Hetze und Unterdrückung missbraucht wird.
Woher stammt das Kopftuch? Seit wann wird es getragen? Inwiefern handelt es sich beim Tragen eines Kopftuches um eine religiöse, spirituelle oder gesellschaftliche Konvention? Wo ist eine Verpflichtung zum Tragen eines Kopftuchs im Koran festgeschrieben? Welchen Bedeutungswandel hat das Kopftuch über die Jahrhunderte erfahren?
Wie bereits erwähnt, gibt der Koran, die verbindliche Hauptquelle des Islams, zu diesen Fragen keine Auskunft. Für einen ideologischen Anspruch ist er also untauglich – leider sehen das nicht alle islamischen Exegeten so.
Er besteht aus 114 Suren, die auch als Kapitel bezeichnet werden. Jede Sure hat drei bis 300 Verse. Die Gesamtzahl der Verse im Koran beläuft sich auf 6.263.
In drei Versen findet sich die Formulierung „den Körper bedecken“ (Sure 24, Verse 31 und 60 sowie Sure 33, Vers 59). Das Wort „Kopftuch“ selbst wird in diesen drei Versen aber gar nicht erwähnt.
In der Bibel wird das Kopftuch sowohl im Alten als auch im Neuen Testament nicht nur erwähnt, sondern den Frauen sogar vorgeschrieben (vgl. Paulus, 1. Korintherbrief 11,6).
In den vergangenen Jahren wurde berichtet, dass die Medizinische Universität Graz ihren Studierenden die Vollverschleierung verbietet.
Gemäß einer Erhebung der EU-Grundrechtsagentur aus dem vergangenen Jahr tragen in Österreich 64 % und in Deutschland 27 % aller Frauen türkischer Abstammung ein Kopftuch.
Somit stellt sich die Frage, ob es sich bei islamischen Kopftüchern um ein religiöses Gebot handelt – dann müsste dieses allerdings im Koran stehen – oder ob es sich vielmehr um ein historisch gewachsenes, politisch-religiöses Phänomen handelt, das sich auf den Einfluss politischer und kultureller Traditionen zurückführen lässt. Da das Kopftuch aber nicht im Koran erwähnt wird, kann es auch kein Gebot dazu geben.
Das häufig angeführte Argument, das Kopftuch solle „vor den Blicken der Männer schützen”, erscheint in unserer aufgeklärten Zeit jedenfalls vielen Leuten absurd und selbst im traditionell-historischen Kontext nicht ganz stimmig …
Die Befürworterinnen und Befürworter des Kopftuchs leiten ihre wahrgenommene Verpflichtung zur Verhüllung dennoch aus dem Koran ab. Es empfiehlt sich daher, ihnen jene Suren und Verse des Korans entgegenzuhalten, auf die sie sich selbst berufen.
In drei Suren kommt ein „Tuch“, aber kein „Kopftuch“ vor:
Koran (Sure 24, Vers 31):
„Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren, ihren Schmuck [d. h. die Körperteile, an denen sie Schmuck tragen] nicht offen zeigen, mit Ausnahme dessen, was sonst sichtbar ist.” Sie sollen ihren Schleier auf den Kleiderausschnitt schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, es sei denn, sie zeigen ihn ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen, die ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Trieb mehr haben, oder den Kindern, die die Blöße der Frauen nicht beachten. Sie sollen ihre Füße nicht aneinanderschlagen, damit nicht sichtbar wird, welchen Schmuck sie verborgen tragen. Bekehrt euch allesamt zu Gott, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehe.
[„Schmuck” wird häufig auch mit „Reize” übersetzt, „Kleiderausschnitt” häufig mit „Busen”.]
Koran (Sure 24, Vers 60)
Für Frauen, die sich zur Ruhe gesetzt haben und nicht mehr zu heiraten hoffen, ist es kein Vergehen, wenn sie ihre Kleider ablegen, jedoch dürfen sie dabei keinen Schmuck zur Schau stellen. Und besser wäre es für sie, wenn sie sich dessen enthalten würden. Und Gott hört und weiß alles.
Koran (Sure 33, Vers 59)
„O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. So wird eher verhindert, dass sie belästigt werden. Und Gott ist voller Vergebung und Barmherzigkeit.
(Quelle: Der Koran. Übersetzung von Adel Theodor Khoury. Unter Mitwirkung von Muhammad Salim Abdullah. Mit einem Geleitwort von Inamullah Khan, Generalsekretär des Islamischen Weltkongresses.) Gütersloh, 2., durchgesehene Auflage 1992).
Bei Betrachtung der oben angeführten Zitate sieht man, dass das Wort „Tuch“ (Überwurf, Schleier, Kleider) vorkommt, nicht jedoch das Wort „Kopftuch“ als solches.
In der Türkei wurden das Kopftuch und der Schleier vor 36 Jahren absichtlich politisiert.
Bis vor 40 Jahren wurde in der Türkei kaum ernsthaft über das Kopftuch diskutiert. Das Tragen des Kopftuchs war seit den 1920er-Jahren staatlich verboten. Erst durch den Militärputsch vom 12. September 1980 und die darauffolgende Politisierung des Kopftuchs durch einige Gruppen aus Saudi-Arabien, Katar und Ägypten, die Religion für ihre politischen Interessen ausnutzten, wurde es zu einem heiklen Propagandainstrument. Das Thema „Kopftuch“ wurde mit den „Migranten“ (eigentlich Politische Islam-Vereine-Parteien) nach Europa importiert und sorgt hier für heftige Diskussionen, auch innerhalb der Migrationsgruppen.
Die Erfahrungen in der Türkei sollten in Österreich, Deutschland und der EU nicht wiederholt werden. Schließlich ist offensichtlich, dass der Islam nirgendwo die Verpflichtung zum Tragen eines Kopftuchs vorschreibt – auch wenn das von einigen Gruppen behauptet wird.
Das „Zeitalter der Ignoranz“, welches vor dem Koran sicher vorherrschte, dürfte sich vielmehr in Bezug auf die geringschätzende Haltung gegenüber Frauen, speziell in jenen Versen, die die Verschleierung betreffen, widerspiegeln. Zahlreiche Verunglimpfungen und Diffamierungen, in denen sogar die Ehefrau des Propheten verleumdet wurde, zeugen davon.
Dementsprechend wurden diese Verse zugunsten der Männer ausgelegt. Betrachtet man jedoch das gesamte Sinngefüge des Korans, wird deutlich, dass Frauen einen gleichwertigen Status wie Männer haben:
Den Frauen wird empfohlen, im gesellschaftlichen Leben mit den Männern zusammenzuleben und in einer solchen Arbeitsatmosphäre sowohl in ihren Beziehungen untereinander als auch in ihrem Verhalten und ihrem Auftreten freundlich zu sein und Übertreibungen zu vermeiden (Sure 24, Vers 31).
Im selben Vers wird erklärt, dass im Kreis der Familie und Verwandten der Schleier kein Muss ist und die Frauen sich frei bewegen können.
Von einem „Kopftuch” ist, wie in allen anderen Versen des Korans, keine Rede.
Auch in der türkischen Übersetzung des Korans werden Sie das Wort „Basörtü” nicht finden.
Es gibt viele Übersetzungen, die dies tun. Wir halten diese Übersetzungen jedoch für unseriös und ideologisch gefärbt.
„Bas“ bedeutet auf Türkisch „Kopf“ und „örtü“ bedeutet „Tuch“.
Ein „Basörtü“ wäre demnach ein „Kopftuch“.
So findet man bei fast allen Auslegungen und Übersetzungen des Korans, sowohl in türkischer als auch in deutscher Sprache, die Übersetzung „Kopftuch“.
In Wahrheit bedeutet das in diesem Vers ausdrücklich erwähnte arabische Wort „Himar“ aber nicht „den Kopf bedecken“, sondern nur „bedecken“. Der Teufel liegt hier im Detail! Der Leser unterliegt also rasch den demagogischen Übersetzungsspielereien. Es sind Taschenspielertricks, mit denen die Gläubigen hinters Licht geführt werden.
Falls im Koran überhaupt etwas explizit bedeckt werden soll, würde dies auch erwähnt werden.
Das ist aber nicht der Fall. Die theologische Begründung der islamischen Gelehrten für das Gebot, ein Kopftuch zu tragen, wird in erster Linie auf die religiöse Intoleranz des Propheten Mohammed und des Korans zurückgeführt.
In Sure 24,31 werden Frauen dazu aufgefordert, ihre Reize vor Männern zu verbergen, jedoch nicht, ihren Kopf zu bedecken.
Dies steht schwarz auf weiß im Koran, beispielsweise in Sure 24, Verse 30 und 31 sowie in Sure 33, Vers 59.
In Übersetzungen wird jedoch in der Regel durch Klammerausdrücke eine willkürliche Interpretation des Korans versucht. Dieser fatalen Praxis ist dringend Einhalt zu gebieten. Wir müssen bei den Fakten bleiben. Persönliche und gesellschaftliche Ansichten dürfen in Interpretationen ebenso wenig einfließen wie tradierte kulturelle Aspekte.
Wir möchten unsere Ausführungen noch mit einem konkreten Beispiel veranschaulichen. Wenn man das Wort „Bettdecke“ verwendet, benutzt man neben dem Wort „decken“ auch das Wort „Bett“, um zu betonen, was genau bedeckt werden soll oder wofür der Gegenstand gebraucht wird. Gemäß dieser Logik müsste für den Begriff „Kopftuch” neben dem Begriff „bedecken” auch das Wort „Kopf” vorkommen.
Das im Vers erwähnte Betonungswort neben dem Wort „Himar/Bedeckung“ ist „Cuyub“, welches aus dem Arabischen übersetzt „Brust“ oder „Kragen“ bedeutet.
Das Wort „Cuyub“ wird auch in einem anderen Vers im Koran erwähnt, nämlich in Sure 28, Vers 32. Dort wird es im Kontext „Er legte seine Hand auf die Brust/den Kragen von Moses“ verwendet.
Wenn das Wort „Cuyub“ also mit dem Wort „Himar/Bedeckung“ kombiniert wird, bedeutet „Bihimürihinne ala Cuyubihinne“ nicht „den Kopf bedecken“, sondern „die Brust bedecken“.
Fast alle traditionellen Auslegungen des Korans analysieren diese Verse nicht im wissenschaftlichen Kontext, sondern deuten sie mit einem Satz wie „Sie sollen ihre Kopftücher bis zu deren Kragen bedecken“, wobei sie auch das Wort „felyedribne“ als „sie sollen bedecken“ interpretieren.
Diese traditionellen Auslegungen des Islam schaffen für den politisierten und traditionellen Islam einen festen, scheinbar unverrückbaren Boden.
Sie interpretieren dasselbe Wort, welches aus dem Wort „Darabe“ stammt, als „sie sollen ihre Kopftücher … bedecken“, wobei sie dasselbe Wort in einer anderen Sure im Zusammenhang mit „Ihr sollt eure Frauen schlagen“ (siehe Sure Nisa, Vers 34) verwenden.
Um es auf den Punkt zu bringen: Obwohl der arabische Originaltext des Korans keinen Bezug auf das Kopftuch nimmt, wird dieses zum identitätsstiftenden Symbol für traditionelle und politisierte Islam-Anhänger. Als solches steht es immer wieder im Zentrum von Islam-Diskussionen – nicht nur in der Türkei, sondern auch in Österreich und anderen europäischen Ländern.
Dabei wird jedoch nicht über den im Koran festgeschriebenen Islam debattiert, sondern über eine Religion, die sich als Folge des politisierten Glaubens der traditionellen Nahostkultur begreifen lässt. Sie hat ihren Ursprung in der sumerischen, jüdischen und christlichen Kultur.
Spurensuche: Kopftuch
Eigentlich hat das Wort „Kopftuch” seine Wurzeln in der Bibel (vgl. 1 Kor 11,6): Im Alten und Neuen Testament wird das Kopftuch nicht nur erwähnt, sondern das Tragen des Kopftuchs wird sogar als Pflicht für Frauen beschrieben.
So heißt es etwa im Brief des Paulus an die Korinther. „Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet, aber dabei ihr Haupt nicht verhüllt […] Sie unterscheidet sich dabei in keinster Weise von dem Geschorenen. Wenn eine Frau das Kopftuch trägt, soll sie sich gleich die Haare abschneiden lassen. Aber es ist eine Schande, sich die Haare abschneiden oder gar kahl scheren zu lassen. Dann soll sie sich eben verhüllen. Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, denn er ist ein Abbild und Abglanz Gottes. Aber der Mann stammt nicht von der Frau ab, sondern die Frau vom Mann.“
Erklärung des Schleiers der Ordensfrauen
Apropos: Die in der Burka-Debatte angestellten Vergleiche mit Ordensfrauen sind jedenfalls bemerkenswert. „Der Schleier der Ordensfrau ist ein religiöses Symbol, das die Bindung an Gott ausdrückt. Das Tragen des Schleiers ist eine freie Entscheidung“, hält die Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden, Sr. Mayrhofer, in der APA-OTS-Presseaussendung vom 19.08.2016 nicht umsonst fest.
Paulus und Kopftuch
Während das Wort Kopftuch im Koran nicht vorkommt, wird es im Alten und Neuen Testament verpflichtend vorgeschrieben.
Unser lieber Landsmann, der heilige Paulus (früher Saulus) aus Tarsus in der heutigen Türkei, ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten der frühchristlichen Zeit.
Die ersten Christen waren wie Paulus und Jesus Christus von jüdischer Herkunft.
Paulus übernahm kulturelle Aspekte aus seiner ehemaligen Religion, dem Judentum.
Wenn wir im Alten Testament, Genesis 24,65, nachlesen, sehen wir, woher der kulturelle Aspekt der Verhüllung bei den Juden stammt und wie er von den Urchristen übernommen wurde: „Und er fragte den Knecht: ‚Wer ist der Mann dort, der uns auf dem Feld entgegenkommt?‘ Der Knecht erwiderte: „Das ist mein Herr. Da nahm sie (Rebekka) den Schleier und verhüllte sich.“ Auch in Gen 38,14 wird über Schleier und Verhüllung geschrieben.
In 1. Korinther 11,2-16 heißt es:
„Ich erkenne es lobend an, dass ihr in allen Beziehungen meiner eingedenk seid und an den Weisungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe.
Wir möchten hier zu bedenken geben, dass das Haupt jedes Mannes Christus ist, das Haupt der Frau aber ist der Mann, und das Haupt Christi ist Gott.
Jeder Mann, der beim Beten oder bei erbaulichen Reden eine Kopfbedeckung trägt, entehrt sein Haupt; jede Frau dagegen, die mit unverhülltem Haupt betet oder erbauliche Reden hält, entehrt ihr Haupt; sie steht dann ja auf völlig gleicher Stufe mit einer Geschorenen (Dirne). Wenn eine Frau sich nicht verschleiert, soll sie sich auch scheren lassen. Wenn es aber für eine Frau schimpflich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, soll sie sich verschleiern. Der Mann darf das Haupt nicht verhüllt haben, weil er Gottes Ebenbild und Abglanz ist; die Frau ist der Abglanz des Mannes. Der Mann stammt ja nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann; auch ist der Mann nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Deshalb muss die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt tragen, um der Engel willen (Menge-Übersetzung).
Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament kann man zur „Kopftuchpflicht während des Gebetes“ lesen: 1. Korinther 11,5–6: „Ein Weib aber, das da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt; denn es ist ebenso viel, als wäre es geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr das Haar ab. Da es aber übel steht, dass eine Frau verschnittenes Haar hat und geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken.“
Paulus: „Die Frau muss ihren ganzen Leib bedecken.“
Ein außerbiblischer Hinweis ist die „Haushaltung Gottes” von Jakob Lorber, in der es in dessen Privatoffenbarung heißt (36,37):
„Seht, ihr alle seid gleich – gleich ihr Männlichen und gleich ihr Weiblichen! Jedoch sollet ihr Weiblichen wohl bedecken eure Schamteile wie auch euren ganzen Leib, und vorzüglich aber euer Haupt, damit durch euer geiles Wesen nicht der Mann zur Unzucht gereizt werde, gleichwie die Schlange lockt durch die große, geheime Lüsternheit ihrer verführerischen Augen das freie Geschlecht der Vögel in die tötende Gefangenschaft ihres giftvollen Rachens; denn ihr Weiber seid zu aller nächst Kinder der Schlange und voll deren Giftes. Seid daher vor allem züchtig wie das Bienenweibchen, das sich nicht traut, mit seinem Wesen ans Licht der Sonne zu kommen, sondern Tag und Nacht sorglich über die Zellen seiner harmlosen Kinderchen kriecht. So solltet ihr auch sein und euren Männern in allem gehorsam sein, insoweit es der allerheiligste Wille Gottes erheischt. Sollte jedoch ein Mann – was nicht zu gedenken ist – euch entgegen des Willen Gottes zu etwas zwingen wollen, so soll euch gestattet sein, euer Haupt vor dem Mann zu entblößen und ihn lieblich an seine Pflichten zu mahnen, die aus Gott hervorgehen. Wenn ihr all dies genau erfüllt, wird der Herr euch mit großen Gnaden überhäufen und ihr werdet zur süßen Augenweide in unendlicher Schönheit des ewigen, heiligen Vaters, ewig und unsterblich.
Im orthodoxen Judentum bedecken verheiratete Frauen aus religiösen Gründen ihre Haare mit einem Kopftuch oder einer Perücke. Bereits in der hebräischen Bibel, also dem Alten Testament, wird die Verschleierung von Frauen erwähnt. So verschleierte sich Rebekka, Isaaks Frau, nach Gen. 24-51, Gen. 24,65: „Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich …“. Nach der modernen Bibelwissenschaft wird der an die Korinther geschriebene Brief des Paulus 11,5 teilweise als späterer Zusatz angesehen. Wie gezeigt wurde, geht aber sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament klar hervor, dass Kopftuch, Schleier und Verhüllung nicht nur empfohlen, sondern verpflichtend vorgeschrieben wurden. Heutzutage wird das Kopftuch im Christentum fast nur noch in ländlichen Gegenden getragen, insbesondere in orthodoxen Kirchen sowie von Frauen in mennonitischen bzw. „teuflischen“ Gemeinschaften.
Während das Wort „Kopftuch” im Koran nicht vorkommt, wird das Tragen eines Kopftuchs im Alten und Neuen Testament verpflichtend vorgeschrieben.
Der Koran meint mit „Tuch” kein Kopftuch, sondern ein Tuch, das den Frauen als Schmuck dient und ihre sexuellen Körperstellen verhüllen soll. In der Geschichte kommt das Kopftuch erstmals bei den Sumerern vor, und das lange vor dem Judentum. Dies fand die 96-jährige türkische Sumerologin und Historikerin Muazzez Ilmiye Çiğ heraus. Sie erforschte ihr Leben lang die Kultur und Geschichte der uralten mesopotamischen Zivilisationen. Wie wir in unserer Ausgabe mit der Coverstory „Stammt das Christentum aus der Türkei?” kurz schilderten, waren die Sumerer ein mesopotamisch-südanatolisches Volk, das um 3000 v. Chr. lebte. Sie waren die Ersten, die das Kopftuch als religiös-spirituelles Medium verwendeten.
Nun wollen wir ein bisschen tiefer in das Thema des Vergleichs der Heiligen Schriften eintauchen und Ihnen erzählen, inwiefern sich die Heiligen Bücher und Schriften voneinander unterscheiden und wo sie Gemeinsamkeiten aufweisen.
Der Koran wird als die Heilige Schrift des Islam definiert. Er enthält gemäß dem Glauben der Muslime die wörtliche Offenbarung Gottes („Allah”), die durch den Engel Gabriel an den islamischen Propheten Mohammed vermittelt wurde. Kurz und prägnant ausgedrückt, stellt der Koran für die Muslime das Wort Gottes dar.
Im Gegensatz dazu ist die Bibel eine Sammlung von 66 Büchern, die von verschiedenen Autoren als Berichte bzw. Poesie verfasst und im Laufe der Jahrhunderte zu einer Einheit zusammengefasst wurden (Quelle: Deutsche Bibelgesellschaft).
Ich verstehe den Begriff „Testament“ als eine Art „Bund“, in dem die Beziehung zwischen Gott und den Menschen beschrieben wird.
Die Bibel umfasst 66 Bücher, von denen 75 % aus Berichten, 15 % aus Poesie und 10 % aus Lehrtexten bestehen.
Das Alte Testament umfasst 39 Bücher, die in Kapitel und Verse eingeteilt sind. Es wird sowohl von Juden als auch von Christen als Heilige Schrift betrachtet.
Es berichtet von der Erschaffung der Welt und von der Entstehung und Geschichte des Volkes Israel.
Das Neue Testament besteht aus 27 Schriften, die sich mit der Ankunft des Messias Jesus Christus als Antwort auf das Alte Testament verstehen. Es erzählt von dem außergewöhnlichen Leben Jesu, von seinen Jüngern und von seiner frohen Botschaft, die allen Menschen gilt.
Vier Bücher (Matthäus, Markus, Lukas und Johannes) bezeugen auf unterschiedliche Weise das Leben Jesu, seine Lehre, seine Wunder, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Sie werden „Evangelien“ genannt.
Die Evangelisten, die Apostelgeschichte und die Briefe erzählen, wie die Jünger Jesu den Tod ihres Herrn, seine Auferstehung und Himmelfahrt miterlebt haben. Sie berichten von den Anfängen der christlichen Gemeinde, von Verfolgungen und Problemen sowie davon, wie sich die gute Botschaft sehr schnell im Römischen Reich, in Kleinasien – dem heutigen Türkei – und schließlich in Athen und Rom ausbreitete. Einige Stellen lassen die Konflikte deutlich werden, die sich ergeben mussten, wenn die strengen jüdischen Regeln, die auch die jüdischen Urchristen einhalten wollten, auf die nicht-jüdische, heidnische Kultur trafen. Schon damals kam es dabei zu Diskussionen unter den Aposteln und Paulus.
Wir müssen hier berücksichtigen, dass der Koran – anders als die Bibel – als direktes Gotteswort konzipiert ist, während das Alte und das Neue Testament in Form von Berichten und Poesie verfasst sind, in die die Worte Gottes eingeflochten sind. Der Koran ist demnach eine Privatoffenbarung an eine einzelne Person. Die Worte wurden, ähnlich wie bei der Johannes-Apokalypse, von einem Engel überbracht oder eingegeben.
Ein Vers der Bibel ergibt nur dann einen Sinn, wenn er im Zusammenhang mit dem gesamten Text betrachtet wird. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn man die Bibel an einer beliebigen Stelle aufschlägt. Natürlich sind manche Abschnitte schwer zu verstehen, weil viele Jahrhunderte zwischen damals und heute vergangen sind und wir die beschriebenen Bräuche und das Umfeld als fremd empfinden.
Der Koran, der aus 114 Kapiteln (Suren) und 6.243 Versen besteht, wurde hingegen als Gotteswort auf ein bestimmtes Ereignis hin offenbart, um eine bestimmte Idee zu verdeutlichen. Um ihn richtig zu interpretieren, muss man den historischen Kontext und die damaligen politischen Umstände kennen.
Der Koran muss aus den Gegebenheiten der Zeit heraus gesehen werden.
Das Evangelische Institut für Islamfragen ist ein Netzwerk von Islamwissenschaftlern und wird von den Evangelischen Allianzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz getragen.
Frau Dr. Christine Schirrmacher schreibt in ihrem Prolog folgende Sätze:
„Heute ist unter Muslimen die Auffassung, dass der Text der Bibel verfälscht worden ist, längst Allgemeingut. Man geht davon aus, dass sowohl das Alte als auch das Neue Testament ursprünglich wahre Offenbarungen Gottes waren, die im Laufe der Zeit von Menschen verändert und verfälscht wurden. Andere Bezeichnungen früherer Schriften, die zu den Menschen gesandt wurden, sind präziser. So nennt der Koran sowohl die Tora (arab. taurâh) als auch das Evangelium (arab. injîl) beim Namen. Das Evangelium wird insgesamt zwölfmal im Koran erwähnt. Doch was genau meint der Koran mit dem Evangelium? Letztlich bleibt unklar, ob er damit vor allem die Erzählungen von Jesus, eines der vier Evangelien, alle vier Evangelien zusammen oder das ganze Neue Testament meint. Interessanterweise wird der Wert früher überlieferter Bücher wie auch des überlieferten Evangeliums zu Beginn von Muhammads Offenbarungen nirgends grundsätzlich infrage gestellt, sondern vielmehr positiv hervorgehoben. Erst später taucht im Koran der pauschale Vorwurf der Schriftverfälschung auf.
Die Sumerologin Prof. Dr. Cig beschrieb folgende Bedeutungen des Kopftuchs:
„In der polytheistischen Religion der Sumerer war es für willige Frauen eine heilige Ehre, in den Tempeln der Götter zu beten und zu danken, indem sie als Braut der Götter zu einer ‚öffentlichen Frau‘ wurden. Damit man sie von anderen Beterinnen unterscheiden konnte, mussten sie ihren Kopf bedecken. Viel später, erst ca. 1600 v. Chr., führte ein assyrischer König die Kopfbedeckung auch für verheiratete und verwitwete Frauen ein. So bekamen diese Frauen den gleichen Status wie die ‚öffentlichen Frauen‘, die legal Geschlechtsverkehr haben durften. Später übernahmen die Juden diese Tradition, danach die Muslime von den Juden. Laut Cig, der viele Werke zu diesem Thema verfasste, tauchte der Turban erstmals bei den Sumerern auf. Er wurde später vom Judentum und Christentum und danach von der arabischen Kultur und somit vom Islam übernommen. Frau Cig betonte, dass der Turban ursprünglich eine sumerische Tradition sei, die später eine enorme göttliche Bedeutung erlangt habe.
Nun kehren wir zum Thema Kopftuch zurück und betrachten es diesmal im Hinblick auf seine Funktionalität und seine historische Entwicklung. Wir fragen uns, was das Kopftuch ist, wozu es dient, seit wann es getragen wird und inwiefern das Tragen eines Kopftuchs eine religiöse, spirituelle oder gesellschaftliche Konvention ist. Wir untersuchen auch, wie sich dieses Phänomen im Laufe der Zeit verändert hat, sodass es zu einer der zentralen Fragen bezüglich Religionsfreiheit und Frauenrechte geworden ist.
Muazzez Ilmiye Çiğ, die 96-jährige türkische Sumerologin und Historikerin, hat ihr Leben lang die Kultur und Geschichte der uralten mesopotamischen Zivilisationen erforscht und herausgefunden, dass das erste Kopftuch in der Geschichte von den Sumerern getragen wurde. Wie in unserer Ausgabe mit der Coverstory „Christentum stammt aus der Türkei?” kurz geschildert, waren die Sumerer, ein mesopotamisch-südanatolisches Volk, das um 3000 v. Chr. lebte, die Ersten, die das Kopftuch als religiös-spirituelles Medium verwendeten.
„Der Turban bzw. das Kopftuch taucht zum ersten Mal bei den Sumerern auf“, meint die Sumerologin. In der polytheistischen Religion der Sumerer war es für willige Frauen eine heilige Ehre, den Göttern in ihren Tempeln zu beten und zu danken, indem sie als Braut der Götter zur „öffentlichen Frau“ (Prostitution) wurden.
Damit man sie von anderen Beterinnen unterscheiden konnte, mussten sie ihren Kopf bedecken.“ Sie fügt hinzu: „Viel später, erst ca. 1600 v. Chr., führte ein assyrischer König die Kopfbedeckung auch für verheiratete und verwitwete Frauen ein. So bekamen diese Frauen den gleichen Status wie die ‚öffentlichen Frauen‘, die legal Geschlechtsverkehr haben durften. Später übernahmen die Juden diese Tradition, danach die Muslime von den Juden.“ Laut Cig, die viele Werke zu diesem Thema verfasst hat, wurde der Turban von den Sumerern erfunden und später vom Judentum und Christentum übernommen und schließlich von der arabischen Kultur und damit dem Islam. „Eigentlich ist der Turban nichts anderes als eine sumerische Tradition, die später eine enorme göttliche Bedeutung erlangte“, so Cig. Nachfolgend ein paar Ausschnitte aus einem Sabah-Interview mit Frau Prof. Dr. Cig:
Die Sumerer, Tempelwirtschaft und Koptuch
„Als Sumerer bezeichnet man ein Volk, das im Gebiet von Sumer im südlichen Mesopotamien im 3. Jahrtausend v. Chr. lebte.
Die Sumerer gelten derzeit als das erste Volk, das den Schritt zur Hochkultur geleistet hat.
Besonders die Erfindung der Keilschrift, die quasi als Urvorlage der heutigen europäischen Schriften gelten kann, gilt als hervorragende Leistung der Sumerer. Zusammen mit der Erfindung der Bürokratie und künstlicher Bewässerung nahm sie hier ihren Anfang.
Die Herkunft der Sumerer ist bis heute nicht endgültig geklärt. In der Wissenschaft gibt es zwei Thesen zur Herkunft der Sumerer. Die eine geht davon aus, dass die Sumerer eingewandert sind. Dies wird an einer entfernten Ähnlichkeit zu agglutinierenden Sprachen wie Ungarisch, Finnisch und Türkisch festgemacht. Deren Ursprung wird in den Uralsteppen gesehen, die somit auch die Heimat der Sumerer wären.
Die Erforschung der sumerischen Kultur erfolgte stets im Zusammenhang mit den anderen mesopotamischen Kulturen. Das liegt an der Charakteristik der Ruinenhügel, die auch als Tells bezeichnet werden. Die Kulturen des Vorderen Orients pflegten nach Zerstörung oder Eroberung, aber auch nach gewissen Zeiten, einen Ort teilweise oder vollständig einzuebnen und darauf eine neue Ebene zu erbauen.
Deshalb kommt es vor, dass die obersten Schichten, wie z. B. in Ninive, mittelalterliche Ruinen bergen, während die unterste Schicht bis in die Zeit um 5000 v. Chr. und weiter zurückreicht. Ein wichtiger Punkt in der Geschichte der Sumerer ist die Wirtschaft, speziell die Tempelwirtschaft. So arbeitete nicht jeder für sich allein auf seinem Feld, sondern für die Allgemeinheit bzw. für den Tempel. Dieser sammelte und verwaltete die Ernte. Diese Art der Vorratshaltung brachte verwaltungstechnische Probleme mit sich, die schließlich zur Erfindung der Schrift durch die Sumerer führten. In der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie bezeichnet der Begriff „Tempelwirtschaft” unter anderem eine geschichtswissenschaftliche These, der zufolge im sumerischen Mesopotamien jede ökonomische Tätigkeit auf die Tempel ausgerichtet gewesen sei. (Ursula Seidl: Ein Monument Darius’ I. aus Babylon. In: Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie 89 (1999), S. 101–114.)
Frage: „Also, Frau Cig, bitte klären Sie uns einmal über das viel umstrittene Thema auf: Wer bei den Sumerern hat sich wieso bedeckt?”
Cig: Bei den Sumerern hatte jeder Gott ein eigenes Haus, sozusagen einen Tempel. In diesen Tempeln beteten die Menschen ihre Götter an. Es war allerdings nicht vorgeschrieben, wie sie dies tun sollten. Sie definierten die Art zu beten für sich selbst und praktizierten ihr eigenes Gebet.
Frage: „Waren diese Tempel also eine Art Häuser des eigenen Gewissens?“
Cig: Genau, diese Tempel waren Orte, an denen Menschen mit ihrem Gewissen allein bleiben konnten. Sie waren in ihren Gebeten freier als in den heutigen Moscheen, Kirchen oder Synagogen. Sie sangen oder tanzten, um die Götter zufriedenzustellen. Unter den Betenden waren auch Ordensfrauen. Manche von ihnen wurden zu sogenannten ‚öffentlichen Frauen‘.
Frage: „Was bedeutet das Wort ‚öffentliche Frau‘ genau?”
Antwort: Das waren Frauen, die Geschlechtsverkehr praktizierten, aber keine Prostituierten waren, da sie kein Geld verlangten. In den Tempeln gab es sogenannte Liebesräume, in denen die öffentlichen Frauen Jugendlichen Sexpraktiken beibrachten. Im Gilgamesch-Epos gibt es eindeutige Hinweise darauf. Um dem Mann, der im Wald unter Tieren aufgewachsen war, Menschlichkeit beizubringen, wurde eine Ordensfrau aus einem Tempel bestellt. Sie brachte ihm bei, wie man spricht, isst und Geschlechtsverkehr hat. Diese öffentlichen Frauen wurden bei den Sumerern als weise Lehrerinnen betrachtet. Während sie dieser heiligen Aufgabe nachgingen, opferten sie sich vollständig im Namen der Götter auf. Eigentlich war die Jungfräulichkeit bei den Sumerern schon ein Thema. Die Tatsache, dass die öffentlichen Frauen trotzdem Geschlechtsverkehr haben durften, zeigt, wie heilig diese Aufgabe war.
Frage: „Woher weiß man, dass die Jungfräulichkeit ein Thema war?”
Antwort: Laut alter Tafeln bekam eine Frau, die vor der Heirat als Jungfrau galt, bei der Scheidung Schadenersatz.
Frage: „Warum trugen die ‚öffentlichen Frauen‘ ein Kopftuch?“
Cig: Damit man sie von anderen Ordensfrauen in den Tempeln unterscheiden konnte. Prostituierte zum Beispiel trugen kein Kopftuch. Das ist das spezielle Symbol der „öffentlichen Frauen” in den Tempeln und somit das erste Kopftuch in der Geschichte.
Frage: „Wie ging es dann weiter?”
Cig: Viel später, im 16. Jahrhundert vor Christus, führten die Assyrer plötzlich die Kopfbedeckung für verheiratete und verwitwete Frauen ein. Der Sinn dahinter war, zu zeigen, dass auch diese Frauen legalen Geschlechtsverkehr hatten.
Frage: „Heißt das, dass eine Frau mit Kopftuch sich als Nichtjungfrau geoutet hat?”
Cig: Ja, ganz genau! Aber viele Gläubige missverstehen diese Tatsache. Sie denken, ich würde behaupten, dass Prostituierte das erste Kopftuch in der Geschichte getragen hätten. Doch weder die öffentlichen Frauen der Sumerer noch die verheirateten und verwitweten Frauen der Assyrer waren Prostituierte.
Frage: „Also diente das Kopftuch einer Frau schon vor Tausenden von Jahren, also vor dem Islam, dem Judentum und dem Christentum, einfach dazu, ihren Status zu zeigen?“
Cig: Das ist genau das, was ich sagen möchte. Nicht ich sage das, sondern die Geschichte. Ich ergänze die Tatsachen nicht und interpretiere sie auch nicht. Ich erzähle nur die wissenschaftlichen Fakten.
Wie man sieht, ist das Tragen eines Kopftuchs eine uralte Tradition im Mittleren Osten und im mesopotamischen Raum.
Was die Verhüllung und das Tuch im Islam betrifft, ist es reine Interpretationssache, wie man die oben erwähnte Sure „Nur” auslegt.
Viele Hermeneutiker und Theologen sind der Meinung, dass mit dem Bedecken von „Scham” und „Schmuck” Geschlechtsorgane und Brüste gemeint sind. Es gibt weder direkt noch indirekt einen Hinweis darauf, dass der Kopf der Frau mit einem Tuch voll verschleiert werden soll.
Im Laufe der Geschichte wurden jedoch in fast allen Religionen einige sittliche und gesellschaftliche Konventionen in das heilige Wort Gottes hineininterpretiert. Dadurch blieben bestimmte gesellschaftliche Rollen, Positionen und damit Machtverhältnisse erhalten. Nachdenklich stimmt allerdings, dass sehr alte Auslegungen und Interpretationen sowie die Interpretationswahrnehmung Dritter, die sich mit dem Thema nicht ernsthaft auseinandergesetzt haben, heute zu ungerechtfertigten Belästigungen und politischer Instrumentalisierung führen. In Gestalt der „Kopftuchdebatte“ konstruieren sie ein gesellschaftspolitisches Problem.
Das größte Gut einer Religion liegt in ihrer Theologie, ihr größtes Übel kommt jedoch ebenfalls aus ihrer Theologie, wenn diese stagniert. Die Angst vor dem Islam ist berechtigt. Im Namen dieser Religion werden die schrecklichsten Verbrechen begangen. Im Namen dieser Religion geschieht derzeit eine ungeheure Barbarei. Wenn Menschen Angst vor dem Islam haben, ist das völlig normal. Selbst wenn ich kein Muslim wäre, würde ich mich fragen, was das für eine Religion ist, auf die sich Verbrecher berufen. Die Tiefe und die geistige Dimension des Korans wurden verschüttet. Stattdessen hat man millimetergenau nachgeahmt, was eine menschliche Person, nämlich der Prophet, getan haben soll.
So läuft man Gefahr, den Islam auf dem Niveau der damaligen Beduinengesellschaft festzuschreiben und ihn für immer im sechsten Jahrhundert nach Christus zu verankern. Die himmlischen Heerscharen scheinen nur damit beschäftigt zu sein, Bekleidungs- und Nahrungsregeln zu erlassen – wie eine himmlische Hausordnung! Das ist eine äußerst platte und ausgetrocknete Vorstellung von Religion! In der Welt der Moscheen herrschen oft noch Dummheit und Unwissenheit. Niemals ein Wort der Selbstkritik. Niemals! Die ganze Welt hat Unrecht und wir ruhen uns auf unserer kleinen Wahrheit aus. Das zeugt von einer Denkfaulheit, wie sie typisch ist für das Ende großer Dynastien. Die Intelligenz der Muslime ist gefangen.
Deshalb ist es falsch zu behaupten, wer den Islam angreift, greift die Muslime an. Für den Islamforscher liegt die beste Möglichkeit zur Bekämpfung des Terrorismus darin, „die religiösen Texte und archaischen Interpretationen und Diskurse anzugreifen, die immer noch Terrorismus hervorbringen und ihn rechtfertigen”. (Soheib Bencheikh, Ex-Großmufti von Marseille, „Zur Zeit”)
Wir hoffen, dass all diese Argumente ausreichen …
Fazit: Im Koran sucht man das Kopftuch vergeblich! Burka, Burkini, Bushija, Hijab, Chador (Abaya) und Niqab sowieso …
Quellen: Der Koran, die Bücher des größten islamischen Denkers des 20. Jahrhunderts, Muhammad Iqbal (gestorben 1938), und die Bücher von Prof. Dr. Yasar Öztürk, Hasan Hanefi, Ali Saitab (Iran) und Mehmet Akif (Türkei).